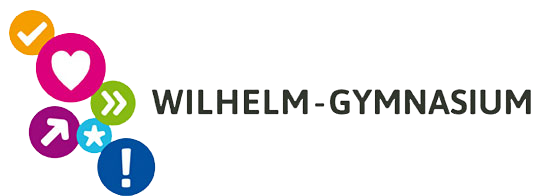Dr. Christos Pantazis, Spitzname „Kitto“, war auf Einladung des Leistungskurses Deutsch, Jg. 13, zu Gast im Wilhelm-Gymnasium. Pantazis, geboren 1975, studierter Humanmediziner, arbeitete neun Jahre als Neurochirurg, ging 2013 für die SPD in den niedersächsischen Landtag und 2021 in den Bundestag. Als schon alle im Klassenraum sind, ruft Karl Lauterbach an, der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Pantazis vertröstet ihn. Er habe jetzt zwei Stunden Wichtigeres zu tun.
Neben Fragen und Antworten zur Corona-Zeit, zur sog. Maskenaffäre und, natürlich, zu Cannabis, ging es vor allem um: Sprache in der Politik.
Schreiben Politiker ihre Reden selber?
„In der Regel schreiben Politiker das selber. Sonst bist das ja nicht du selbst. Das Recherchieren macht das Team, die wissenschaftliche Vorarbeit. Für die Rede bist du aber selbst verantwortlich. Die wird stenografisch festgehalten. Wenn du das Thema zum allerersten Mal beackerst, würde ich empfehlen, das auszuformulieren. Denn wenn du dich vergaloppierst, hast du ein Problem. Wenn du schon im Thema drinsteckst, kannst du auch frei reden.“ Aber „es dürfen nicht die Pferde mit dir durchgehen, insbesondere dann, wenn es plötzlich Zwischenrufe gibt.“ Und: „Jeder der sagt, er würde kein Lampenfieber haben, der lügt“.
Hat sich die politische Sprache verändert, seit er Abgeordneter ist?
„Die Sprache, das muss ich ganz offen sagen, hat sich deutlich verändert. Sie ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Wenn ich ehrlich bin, aus meiner Sicht etwas unparlamentarisch.“ „Die Verrohung der Sprache“ führe dazu, „dass der Respekt massiv sinkt, nicht nur voreinander, sondern auch bei den Leute, die zugucken.“
Es sei „völlig egal“, ob man „total unterschiedlicher Meinung“ sei, „trotz alledem sollte der Respekt voreinander weiter bestehen, dass ich sage, ich respektiere deine Meinung, auch wenn ich sie zu 100% nicht teile. Man sollte die Größe besitzen, den Gegenüber nicht verächtlich zu machen, sondern versuchen, ihn mit anderen Argumenten zu überzeugen oder die Öffentlichkeit. Und nicht durch, ich sage mal, im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie, indem ich nur Wirkungstreffer lande. Also, wie heißt es immer so schön, ChatGPT, formuliere die Rede um und brutalisiere die Sprache. Dann landen wir bei Wörtern wie „Volksverräter“.
Ob er bestimmte Redestrategien hat?
„Ja, es gibt einige Taktiken. Ich persönlich bin kein Fan davon, aber das, was meistens bei einer Rede hängen bleibt, ist nicht der Inhalt. Die Leute achten leider selten auf den Inhalt. Was von einer Rede hängen bleibt, ist meistens die Schlussform. Deswegen versuche ich immer ganz zum Schluss, wenn ich ehrlich bin, neben den klassischen rhetorischen Tricks eine Pointe zu setzen.“ Man müsse auch bedenken: „Oben sitzt die Presse, und wenn du zu kompliziert redest, dann verstehen das die Männer und Frauen da oben nicht. Deswegen musst du auch ein wenig den Bildzeitungsstil wählen, denn du brauchst auch Wirkungstreffer.“
Setzt er bewusst auf Emotionalisierung und gibt es eine Grenze zum Populismus?
„Ich würde es nicht gleich so kategorisieren. Ich finde, Politik überträgt sich viel besser, wenn der Inhalt emotional besetzt ist. Ich mache mal ein Positiv- und ein Negativ-Beispiel. Olaf Scholz, mein ehemaliger Kanzler, der hat seine Reden komplett ausgeschrieben und quasi vorgelesen. Das war so emotionslos, dass ich bei seiner Regierungserklärung fast eingenickt bin.“ Heidi Reichineck dagegen, Vorsitzende der Fraktion Die Linke, sei in der Debatte um die Brandmauer „total aufgebracht“ gewesen und habe „die ganze Zeit auf den Tisch geklopft“, dadurch sei „die Reichweite massiv gestiegen“, was für ihre Partei „wahrscheinlich der Turnaround im Wahlkampf“ gewesen sei.
„Das heißt, ich bin immer ein Freund davon, dass durch Emotionen im politischen Kontext eine deutlich größere Durchschlagskraft entsteht. Und meistens entstehen Emotionen nicht dann, wenn man die Rede vorgeschrieben hat, sondern wenn man vom Redemanuskript abweicht.“
„In der Mediendemokratie“ sei „Aufmerksamkeitsökonomie das A und O“, denn, „ehrlich gesagt, wer liest sich denn noch Parteiprogramme durch?“ „Die Leute emotionalisieren sehr stark. Die Leute personalisieren sehr stark.“
Wie bewertet Pantazis, wenn sich Politiker an der Alltags- und Jugendsprache orientieren?
„Seien wir doch mal ehrlich. Würden Politiker bei TikTok lustige Videos von sich machen, wenn sie nicht die Jugend erreichen wollten? Ehrlich gesagt, wenn ich nicht mehr politisch aktiv bin, das erste, was ich abschalten würde, wäre mein Social-Media-Kanal. Das geht mir so auf den ***. [Zu seiner Social-Media-Mitarbeiterin, die ihn bei dem Gespräch begleitet:] Nicht böse sein. Es heißt, du musst jetzt das noch machen und das noch, denn das kommt momentan gut an. Das ist gerade viral. Und dann hast du lustige Musik und 10 000 Klicks. Was ist denn der Sinn? Sorry. Ich bin zu einer Zeit großgeworden, da gab es keine Handys. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich im Urlaub mein Essen fotografiert habe. Aber natürlich ist das ein Stilmittel: Ich bin einer von euch. Ich weiß, wie ihr denkt. Ich spreche eure Sprache.“
Ob er eine bestimmte Sprache auch für Parteien der Mitte empfehlen würde?
„Wer es will, keine Frage. Die Frage ist nur: Ist die Sprache herabwürdigend? Ist sie eventuell eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Und wenn man es lustig bemäntelt, dann wird es schwierig. Aber das Stilmittel, Jugendsprache einzubauen: Warum nicht?“. Es gehe darum, „nahbarer zu wirken“. „Aber ich habe manchmal den Eindruck, in der aktuellen Debatte leidet der Inhalt. Es geht nur noch um Aufmerksamkeit. Nur noch um Wirkungstreffer. Und nur noch darum, durch eine Brutalisierung der Sprache eine Empörungswelle auszulösen. Denn negative Schlagzeilen, sind ja auch Schlagzeilen.“
Das sei wie bei einer Autofahrt von Braunschweig nach München, bei der man an einem schweren Verkehrsunfall vorbeikomme. An die Fahrt erinnere sich niemand mehr, nur an den Unfall. „Und je stärker der Unfall ist, desto mehr Aufmerksamkeit erreichst du. Das ärgert mich. Deswegen habe ich den Eindruck, dass Berlin etwas für Schaumschläger ist. Die Leute, die Gesetze Tag und Nacht verhandeln, die sitzen nicht bei Lanz in der Talkshow. Die haben keine Zeit, um ihren Scheiß abzusondern. Entschuldige. Das ist substanzlos. Und das hast du mittlerweile sehr häufig.“
Bei Abgeordneten, die Mitglied einer Regierungspartei seien, mache, wie bei ihm, „vielleicht eine Person Social Media. Das läuft auch ziemlich gut. Ich will das gar nicht negieren. Aber alle anderen, die für mich arbeiten, das sind wissenschaftliche Mitarbeiter. Die analysieren Gesetze. Schreiben Texte. Wie gehen wir strategisch vor. Wenn ich aber in der Opposition bin, verwende ich mein gesamtes Geld in Social Media. Und dann mache ich super geile Videos und habe 30 000 bis 40 000 Follower. Ehrlich gesagt, das hat wenig Substanz. Das ist es, was mich ärgert. Denn die bekommen durch die Medien, die Aufmerksamkeitsökonomie, deutlich mehr Reichweite. Und die, die eigentlich im Maschinenraum ackern, nicht. Berlin ist ein bisschen was für Schaumschläger.“
Was hat das Politikerdasein für Auswirkungen auf sein Leben?
„Jeder macht mal einen Blödsinn oder äußert sich ein bisschen falsch. Politiker sind auch Menschen. Trotz alledem sind wir Personen des öffentlichen Lebens. Das heißt, wir stehen total im Fokus. Man muss wissen, was das für Auswirkungen mit sich bringt.“ Man müsse eine „professionelle Distanz aufbauen. Du kannst nicht einfach so um die Ecke gehen und sagen, ich zeige jetzt mal einen Stinkefinger, weil der mich gerade beleidigt hat.“
„Wie heißt es immer so schön, wenn wir ein Fußballspiel verlieren? Hey Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Und hier heißt es jetzt, hey, ich weiß, wo du wohnst. Das kannst du ja schnell rausbekommen. Und natürlich gibt es eine ganze Menge Drohmails. Das hat an Intensität massiv zugenommen. Gott sei Dank muss das meine Mutter nicht lesen. Von „Kameltreiber, geh dahin, wo du herkommst“ über „als Grieche kennst du dich ja mit Schulden gut aus“ bis „ich will dich am nächsten Baum hängen sehen“ sei alles dabei.
Was Worte anrichten können.
„Worte können sehr verletzend sein. Natürlich muss die Politik über Emotionen laufen. Aber das, was wir miteinander diskutiert haben, darf nie das Ansehen des Gegenübers unterlaufen. Man hat eine Verantwortung. Man hat auch eine Vorbildfunktion als Politiker. Alles hat seine Konsequenzen. Alles, was ich mache.“ „Das Klima hat sich schon sehr stark verändert.“
„Ich persönlich bin ein Freund des Inhalts. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die Mediendemokratie und Social Media eher die Verpackung zum Glänzen bringen. Das ist mir zu wenig. Und was mir Sorgen macht, sind die Kampagnen, die sehr niedrigschwellig und sehr subtil laufen.“
„Bei der Presse gibt es einen Presserat. Es gibt eine Möglichkeit der Gegendarstellung. Und es gibt Kontrollinstanzen. Im Internet gibt es keine Kontrollinstanzen. Im Internet kann ich behaupten, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Alle gucken sich das an und sagen, ha, es gibt doch einen, der behauptet, es sei 5.“ Da werden „Narrative verbreitet, die wissenschaftlich totaler Humbug sind. Und trotz alledem verfangen die schrittweise.”
Wie bewertet Pantazis den Satz des Bundeskanzlers Friedrich Merz, „wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“, geäußert im Kontext mit Migration?
„Also, wenn jemand möchte, dass man richtig verstanden wird, dann äußert er sich auch entsprechend. Wenn jemand möchte, dass es im Ungefähren bleibt, dann äußert man sich halt entsprechend so. Das ist wirklich Kalkül.“ Es gebe ein „soziales Problem, wir haben ein Problem der finanziell nicht gut ausgestatteten Kommunen“, es gebe eine Verwahrlosung, weil durch den digitalen Handel die Geschäfte in den Innenstädten dicht machten, es gebe sicherlich auch patriarchale Kulturen, aber „das nur auf Migration runterzubrechen, ist mir zu billig, zu einseitig.“ „Da wird Sprache zur Waffe gemacht. Das heißt, ich kann auch nicht einfach so etwas in die Welt setzen, die Leute bewusst im Unklaren lassen, dass jeder das hören kann, was er will.“
„Es ist ein Unterschied, ob ich [wie in den USA] sage, ich bin Verteidigungsminister oder ich bin Kriegsminister. Und in der Migrationsdebatte ist es ein Unterschied, ob ich sage, Schutzsuchender oder Asylant. Die grobe Position ist die gleiche. Aber es ist eine ganz andere Perspektive. Und es ist eine ganz andere Wertung. Deswegen ist es für mich verräterisch, wie man da Sprache einsetzt.“
Wie kann man Leute mit Politikverdrossenheit wieder einbinden?
Das Problem sei doch, wenn ein Politiker in den Nachrichten oder in einer Talkshow zu Wort komme, dann antworte „keiner mit Ja oder Nein, sondern alle fangen an, um den heißen Brei zu labern und beantworten die Frage nicht.“ Politiker „wollen ja von allen gewählt werden und versuchen dann die ganze Zeit, wie sagt man so schön, das Nein in ein Ja zu verpacken.“
„Ich glaube nicht, dass es eine Politikverdrossenheit gibt. Es gibt eine Politikerverdrossenheit. Die Leute wollen gerne wissen, woran sie sind.“
Zusammengestellt von Dr. Alexander Huber